SOZIALWISSENSCHAFTEN
Rückblick auf ein kooperatives Forschungsprojekt mit dem Projektbüro Angewandte SozialforschungEvaluation des Hamburger Polizeimuseums
23. Oktober 2020
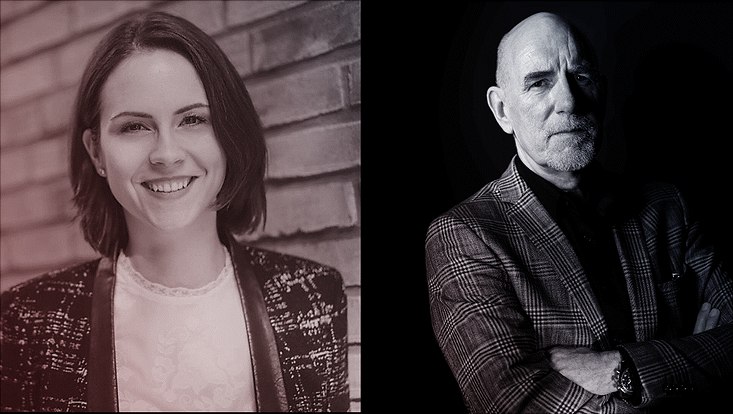
Foto: Linda Köhlmann/Joachim Schulz
Wer besucht das Polizeimuseum Hamburg? Was möchten Besucher*innen über die Polizeiarbeit erfahren? Diese und weitere Fragen wurden in einer umfangreichen Besucher*innen Evaluation im Rahmen der Forschungskooperation zwischen dem Projektbüro Angewandte Sozialforschung und dem Hamburg Polizeimuseum bearbeitet. Was das Forschungsprojekt dem Museum gebracht hat und welche Schlüsse aus der Kooperation gezogen wurden, darüber berichten drei Jahre nach Abschluss Joachim Schulz, Leiter des Polizeimuseums Hamburg, und Linda Köhlmann, damalige studentische Mitarbeiterin im Forschungsprojekt.
Herr Schulz, Sie sind 2017 auf das Projektbüro Angewandte Sozialforschung zugekommen. Was war damals das Forschungsinteresse des Polizeimuseums Hamburg?
Joachim Schulz: Grundsätzlich wollten wir wissen, ob wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind. Konkret hieß das: Wer besucht unser Museum und welche Wünsche haben unsere Besucher*innen über die bestehenden Angebote unserer Ausstellung hinaus? Wir hatten ein gutes Bauchgefühl, aber es war uns wichtig, diese Fragen unabhängig und wissenschaftlich bearbeiten zu lassen.
Frau Köhlmann, sie waren damals studentische Mitarbeiterin im Projekt. Wie lief dann konkret der Forschungsprozess ab?
Linda Köhlmann: Zusammen mit einem weiteren Kommilitonen und der wissenschaftlichen Leiterin des Projektes, Kea Glaß, haben wir nach einigen Vorgesprächen mit dem Museums-Team einen quantitativen Fragebogen erstellt, den wir per Paper-Pencil-Befragung die Besucher*innen vor Ort haben ausfüllen lassen. Auch die ehrenamtlichen Museums-Mitarbeiter*innen, die die Besucher*innen durch die Ausstellung führen, haben uns bei der Akquirierung und bei Nachfragen der Teilnehmenden sehr unterstützt. Vier Wochen waren wir vor Ort und hatten am Ende 860 ausgefüllte Fragebögen. Das war ziemlich überraschend für uns, denn wir hatten zuvor mit 200 Fragebögen kalkuliert.
Joachim Schulz: Stimmt. Wir hatten ehrlich gesagt vorher die Sorge, dass nicht ausreichend Besucher*innen an der Befragung teilnehmen werden. Immerhin war der Fragebogen elf Seiten lang. Aber es kam wirklich sehr selten vor, dass jemand nicht an der Befragung teilnehmen wollte. Das war echt eine tolle Atmosphäre.
Linda Köhlmann: Ja, zudem gab es auch für alle Teilnehmenden ein Los für unsere Tombola. Das hat auf jeden Fall bei den Besucher*innen für große Begeisterung gesorgt. Letztendlich haben wir dann einen umfassenden Forschungsbericht erstellt und die zentralen Ergebnisse schließlich auch vor der Leitungsebene der Polizei Hamburg präsentiert.
Was waren denn die zentralen Ergebnisse aus der Befragung?
Joachim Schulz: Insgesamt hat sich gezeigt, dass wir mit unserem Bauchgefühl richtiglagen. 99 Prozent der Befragten gaben an, dass sie Spaß bei ihrem Besuch hatten. Zudem gaben knapp 95 Prozent an, dass sie viele neue Dinge über die Polizei gelernt haben und knapp 57 Prozent nehmen daraus mehr Verständnis für die Polizeiarbeit mit. Das zeigt, dass unser Konzept aufgeht, denn das Museum soll nicht nur ein reines Freizeitangebot sein, sondern auch die Besucher*innen über die Polizeiarbeit aufklären. Aber natürlich hatten auch viele Besucher*innen Vorschläge für Verbesserungen.
Linda Köhlmann: Ja, ein Punkt waren zum Beispiel die Öffnungszeiten. Die Besucher*innen haben sich gewünscht, dass das Museum unter der Woche länger geöffnet hat und auch am Samstag Besuchszeiten anbietet. Bei der Frage, welche Ausstellungsinhalte und –stücke sich die Besucher*innen noch wünschen, wurde sehr häufig das Ausstellen von weiteren Polizeiautos genannt.
Herr Schulz, die Befragung liegt nun drei Jahre zurück. Wie konnten sie mit den Forschungsergebnissen arbeiten?
Joachim Schulz: Leider konnten wir nicht auf alle Wünsche der Befragten eingehen. So konnten wir unser Öffnungszeiten bisher nicht erweitern, da uns einfach nicht mehr Personal zur Verfügung steht. An dem Wunsch historische Polizeiautos auszustellen, sind wir weiterhin sehr bemüht. Aber auch dafür müssen erst die entsprechenden Umbaumaßnahmen genehmigt und umgesetzt werden. Zudem kam bei der Forschung heraus, dass die Mehrheit unser Besucher*innen aus dem Umland von Hamburg kommen und nur knapp 50 Prozent aus Hamburg selbst. Daraufhin haben wir unterschiedliche Werbemaßnahmen in der Stadt durchgeführt, mit dem einfachen Ziel, das Polizei Museum unter den Hamburger*innen bekannter zu machen.
Ein zentrales Ergebnis war auch, dass unsere Besucher*innenschaft – wie bei fast allen Museen übrigens - hinsichtlich ihrer sozidemographischen Merkmale, wie zum Beispiel Alter und Schulabschluss, diverser sein könnte. Um hier die Diversität zu erhöhen und unsere Ausstellung barriereärmer zu gestalten, sind wir aktuell dabei, unsere Ausstellungstafeln und Multimedia-Guides in einfache Sprache umzugestalten.
Frau Köhlmann, Sie waren damals Studentin. Was konnten Sie aus diesem Forschungsprojekt für Ihren weiteren Studienverlauf lernen?
Linda Köhlmann: Ich würde sagen, dass dieses Forschungsprojekt für mich auf ganz unterschiedlichen Ebenen sehr spannend war. Zum einen habe ich bestimmte Kompetenzen erweitern können, wie zum Beispiel Zeitmanagement. Gerade für meine darauffolgende Master-Abschlussarbeit hatte ich eine viel bessere Vorstellung davon, welche Arbeitsschritte zu einem Forschungsprozess dazugehören und wie viel Zeit jeweils dafür einzuplanen ist. Zudem habe ich aus der Zusammenarbeit mit den anderen Forscher*innen aus dem Team viel lernen können und habe so unter anderem einige wichtige Statistik-Skills dazugewonnen. Spannend war für mich aber auch die Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner. Zu sehen, dass die Forschungsergebnisse unmittelbar Einrichtungen wie dem Polizeimuseum weiterhelfen können, hat bei mir für eine ganz andere Motivation gesorgt, als wenn ich mir sonst in meinen Hausarbeiten eine Forschungsfrage ausdenken muss, die mit der Praxis erstmal nichts zu tun hat. Zudem war es für mich interessant, mit Menschen in einem Team zusammenzuarbeiten, deren Arbeitsweisen ganz andere sind, als ich es sonst zum Beispiel aus Seminaren und Hausarbeiten innerhalb meiner Uni-Bubble gewöhnt bin. Aber dann zu sehen, dass es funktioniert und man einen gemeinsamen Weg findet, war toll.
Joachim Schulz: Das war wirklich so: Wir ziehen an einem Strang, wir haben ein gemeinsames Thema und jeder bringt sein Wissen mit und zusammen wird es richtig gut. Das war wirklich eine aufregende Zeit, dieses Projekt von Anfang bis Ende gemeinsam zu planen und durchzuführen.
Warum sind solche Forschungskooperationen Ihrer Meinung nach wichtig, Herr Schulz?
Joachim Schulz: So eine Studie ist für unsere Arbeit enorm wichtig gewesen, da sie uns einen differenzierten Einblick in unser Arbeitsfeld ermöglicht hat. Unterm Strich hatten wir zwar ein gutes Bauchgefühl, wie unser Museum ankommt, mit den Ergebnissen haben wir aber nun gezielt die Möglichkeit, zielgruppenspezifisch Maßnahmen zur Verbesserung der Museumsarbeit durchzuführen. Deswegen ist es so wichtig, dass eine Einrichtung wie das Projektbüro eine wissenschaftliche Evaluation unserer Arbeit durchgeführt hat. Diese Forschungsergebnisse ermöglichen es uns auch innerhalb der Polizei Hamburgs für eine höhere Anerkennung des Museums als zentrale Säule unserer Öffentlichkeitsarbeit zu sorgen. Zudem waren die Ergebnisse auch ein wichtiger Motivationsfaktor für unsere Mitarbeitenden, denn sie zeigten, dass sie mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz dem Anspruch des Museums mehr als gerecht werden.


