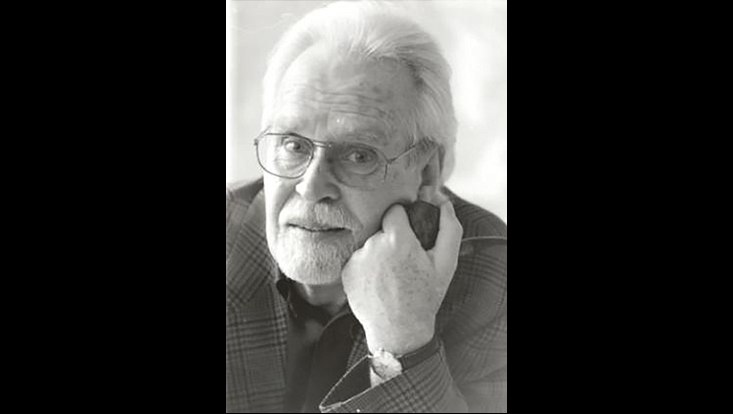Zwischen Schönheit, Gegensätzen und TabusErfahrungsbericht zum Japanaufenthalt mit dem MIRAI Programm 2017
17. Januar 2018

Foto: Daniela Friedrich
Vom 6. bis zum 13. Dezember 2017 verbrachte ich, Daniela Friedrich, im MIRAI Programm der japanischen Regierung, eine Woche in Japan. In Tokyo, Hiroshima und Kyoto sammelte ich Eindrücke des Landes, in dem die Schönheit sogar in den Häuserschluchten lauert und das im Vergleich zu Deutschland unterschiedlicher kaum sein kann.
von Daniela Friedrich, Masterstudentin „Journalistik und Kommunikationswissenschaft“
Es scheint, als seien die Hochhausriesen, die uns in Tokyo begrüßen komponiert. Sogar die grellen Werbetafeln, die das Stadtbild im Detail fast surreal erscheinen lassen, sind auf eine Art und Weise gefällig für das Auge. Die Hauptstadt Japans mit seinen etwa 10 Millionen Einwohnern im Zentrum und fast 40 Millionen in der Peripherie ist gewaltig. Und dennoch schön. Mit dem Bus holen uns Vertreter des MIRAI Programms am Flughafen ab und schon auf dem Weg zum Mittagessen im 37. Stockwerk eines Wolkenkratzers bekommen wir einen ersten Eindruck dieser Weltstadt, die ich bis dato nur aus dem Fernsehen und dem Internet kannte. Der Ausblick war atemberaubend, das Essen köstlich japanisch, reich an Fisch und arm an Kohlehydraten. Wir, das sind etwa 80 Studierende aus ganz Europa, die von der Japanischen Regierung für eine Woche nach Japan eingeladen wurden. Das MIRAI Programm, finanziert aus japanischen Steuergeldern, möchte Kultur, Ideologie und Politik Japans im Westen der Welt bekannter machen und präsentierte uns dieses Land von seiner schönsten Seite. Sogar die Sonne schien fast durchgehend wie bestellt und der japanische Winter war mit 10 bis 20° C geradezu frühlingshaft.
Nach dem Mittag durften wir in unser Hotel, aus dessen Fenstern im 30. Stock wir erneut erinnert wurden, wie gewaltig groß Tokyo ist. Den Nachmittag und Abend nutzte ich mit einigen Studierenden aus Deutschland, Griechenland, der Ukraine und Italien um uns die berühmte Shibuya Kreuzung und dessen Umgebung anzusehen. Es ist genauso voll, laut und verwirrend, wie ich es mir vorgestellt hatte. Obwohl die Japaner sich in der Öffentlichkeit kaum laut unterhalten, herrscht dank singender und sprechender Werbetafeln ein Geräuschpegel, der kaum zu ertragen ist.

Den zweiten Tag in Japan verbrachten wir im Außenministerium des Landes, wo wir eine Einführung in Japans Bemühungen erhielten, japanische Literatur ins Englische zu übersetzen. Die „Japan Library“ veröffentlicht ausgewählte Literaturschätze für ein internationales Publikum. In dem Zusammenhang lernten wir die Bedeutung von Japans Businessleadern kennen und diskutierten im Anschluss miteinander, welche Businessleader in unserer Heimat Einfluss hatten und ob eine gute Wirtschaft diese Persönlichkeiten wohl brauche. Der Jetlag hatte uns alle an diesem Tag hart getroffen, weshalb ein anderer Tag sicher eine lebendigere Diskussion ergeben hätte.
Am dritten Tag besuchten wir das Tokyo National Museum und im Anschluss das Hochhaus Roppongi Hills, Symbol japanischer IT Industrie, auf dessen Dach eine Aussichtsplattform begehbar ist. Der Ausblick offenbarte die gewaltige Größe dieser Stadt erneut und ließ uns trotz Nebel, der die Riesen aus Beton umwaberte, erahnen, welch Dimensionen dort gelten. Hier begegneten wir auch einer Frau, deren Verneigung mir zu denken gab. In Japan gibt man sich zur Begrüßung, Dank oder Abschied nie die Hand, man verneigt sich. Je tiefer, desto ehrfürchtiger, respektvoller, unterwürfiger. Die meisten Japaner nickten uns kurz mit dem Kopf zu, eine Geste, die ich gern erwiderte und auch bei mir ein Gefühl von gegenseitigem Respekt hervorrief. In Japan steht vor fast jedem Fahrstuhl eine Person, die die Knöpfe drückt, die Türen aufhält bis alle eingestiegen sind und den reibungslosen Ablauf beim Aufzugfahren gewährleistet. Die Frau in den Rappongi Hills tat ihre Aufgabe und zum Abschluss verneigte sie sich so tief, dass ihre Stirn auf Höhe ihrer Knie sank. Dort verblieb sie, bis sich die Fahrstuhltür zwischen ihr und unseren fassungslosen Gesichtern schloss. Diese Geste vermittelte uns keinen Respekt auf Augenhöhe sondern unterwürfige Demut, die wir nicht annehmen konnten und wollten. Noch eine ganze Weile danach führten wir Diskussionen über kulturelle Unterschiede.
Am Abend noch nahmen wir, nun eingeteilt in zwei Gruppen á 40 Studierenden, den japanischen Schnellzug Shinkansen Richtung Hiroshima, der immer pünktlich ist und nur genau eine Minute am Gleis hält. Dass alle Reisenden in dieser einen Minute aussteigen und 40 aufgeregte Europäer einsteigen konnten, verdanken wir dem Organisationstalent unserer Betreuerinnen Matschiko, Ayoko und Hiroko. Am nächsten Morgen, dem vierten Tag, besuchten wir den Itsukushima Schrein auf Miyajima, einer Insel bei Hiroshima. Hier erschlug uns die Schönheit erneut auf eine ganz neue Art und Weise. Immer wieder erinnerten wir uns gegenseitig, dass dies keine fantastische Filmkulisse, sondern realer Ort religiöser Praxis ist. Die rot gestrichene Tempelanlage liegt farblich komplementär in immergrünen und herbstlich verfärbten Wäldern, in denen Rehe frei und sehr zutraulich leben und Gebäck mit – meiner Meinung nach entsetzlicher – Bohnenmusfüllung Uneinigkeit über den Geschmack dieser Spezialität in unserer Gruppe auslösten.
Den Nachmittag verbrachten wir in Hiroshima. Hier fiel am 6. August 1945 morgens um 8:15 Uhr die erste Atombombe der Menschheitsgeschichte, die die gesamte Stadt zerstörte. Wir erfuhren von einer Überlebenden und im Museum, welches Ausmaß diese Waffe erreichte, dass im Umkreis von fünf Kilometern alles Lebende und die meisten Häuser sofort verbrannten. Die nukleare Strahlung tötete in den Tagen, Wochen, Monaten und Jahren danach noch viele weitere Menschen. Die Ausstellung im Museum in Hiroshima zeigt die Zerstörung und das damit einhergegangene Leid der der Menschen sehr eindringlich und rührend. Über diese Erlebnisse hielt ich am letzten Tag der Reise vor allen Teilnehmern als eine von zwei Studierenden eine dreiminütige Rede zu meiner Perspektive als Deutsche auf diese Eindrücke.
Am Abend fuhren wir mit dem Shinkansen nach Kyoto, wo wir uns einen Einblick in das Nachtleben junger Japaner verschafften und am nächsten, dem fünften Tag die wunderschönen Tempel Kinkakuji (Golden Pavilion Temple) und Higashi Honganji Temple sehen durften. Die Eile, in der wir diese wundervollen Orte bestaunten, ließ das Gefühl zurück, dorthin zurückkehren zu müssen, um die atemberaubenden Anblicke im eigenen Tempo genießen und erkunden zu können. Doch Eile war geboten. Denn ein dritter Programmpunkt wartete schon auf uns: Wir erhielten eine Einführung in das traditionell japanische Theater. Maskierte Männer erzählen mit Tanz, Gesang und Klängen, skurril für westlich kultivierte Augen und Ohren, Geschichten von Kriegern und Liebenden.

Am Abend erreichten wir erneut Tokyo mit dem Shinkansen und kehrten in das Hotel zurück, das wir bereits von den ersten zwei Nächten kannten. Den nächsten und sechsten Tag in Japan verbrachten wir an der WASEDA Universität in Tokyo, wo wir japanische Studierende kennenlernten und zur Entwicklung der Mangakultur, der Wissenschaft „Japonisme“ und dem „All Japan Approach to International Peace Operation“ in Vorlesungen lernten. Der wunderschöne Campus und das fantastische Essen in der Mensa zusammen mit japanischen Studierenden rundeten diesen Tag ab.
Am siebten und letzten Tag fuhren wir morgens erneut in das Außenministerium, um Einblicke in die Verteidigungspolitik des Landes zu erhalten. Hier trugen ich und ein weitere Studierender aus Griechenland unsere Eindrücke der Reise vor. Im Anschluss lernten wir mit dem ehemaligen Eisschnellläufer Manabu Horii noch einen Vertreter des Außenministeriums persönlich kennen, der uns bei einem Abschlussessen an unserem Tischen besuchte. Wir durften den Raum nicht verlassen, solange die Person anwesend war. Stand er an unserem Tisch, durften wir den Tisch nicht verlassen. Die Situation, die Begrüßung und unser Verhalten probten wir, bevor der Vertreter kam, ausführlich. Die Betreuer des MIRAI Programms waren zwischen Ehrfurcht, Sorge um den reibungslosen Ablauf und Aufregung hin und hergerissen, was uns insgesamt mehr irritierte als uns Sicherheit im Umgang gab. Doch offenbarte diese Situation auch die kulturell fest verankerte Bedeutung von Hierarchien in Japan, die das soziale Leben zu durchdringen scheinen.
Nach einen reichhaltigen Buffet im Anschluss durften wir den Nachmittag frei nutzen. Ich besuchte den Stadtteil Akihabara, die Elektronikmeile der Geeks und Nerds, sowie die Takeshita Street, eine 350 Meter lange Einkaufsstraße in der sich die japanische Kawaii-Kultur, die für Niedlichkeit und Unschuld steht, konzentriert. Am nächsten Morgen fuhren wir nach einer langen Nacht zum Flughafen, um nicht ohne Wehmut die Heimreise anzutreten. In dieser Woche hat uns Japan gezeigt, wie es sich gern nach außen präsentiert. Schön, friedvoll, ehrgeizig und erfolgreich. Nur zwischen den perfekt getimten Abläufen, in ungeplanten Situationen und in Begegnungen außerhalb des Programms blitzten auch die Schwächen und Probleme auf, die man in Japan aus Höflichkeit niemals ansprechen würde. Die perfekte Fassade ist Teil des Bildes, das Japan nach außen präsentieren möchte – verständlich. Unterm Strich wirkt dieses Bild – vielleicht aus Perspektive westlicher Werte – doch einseitig und unvollständig. Ich wünschte, Japan würde sich zu seiner ganzen Identität bekennen, was es nicht weniger liebenswert machte. Denn Japan ist trotzdem wunderschön, voller guter Werte, voll von unglaublich liebenswerten und freundlichen Menschen, ein Mekka für Feinschmecker, vielfältig, angenehm stolz auf Kultur und Geschichte und jede lange Reise wert. Am Ende nahmen sich alle Teilnehmer des MIRAI Programms vor, zurückzukehren, um dieses Land mit all seinen Facetten und genügend Zeit noch besser kennenlernen zu können.