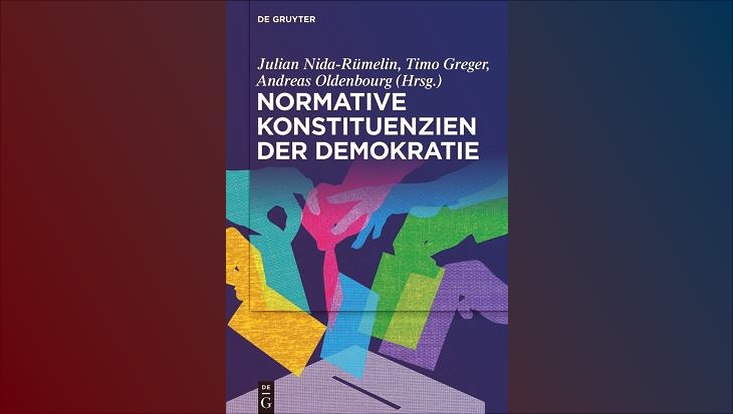Nachruf auf Prof. Dr. Ingeborg Maus
16. Dezember 2024
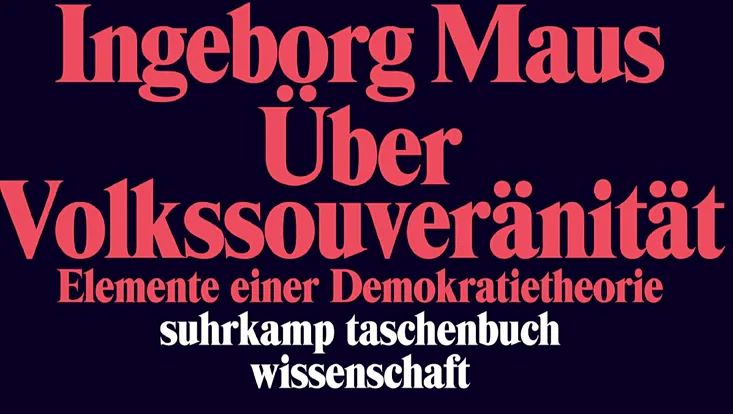
Foto: suhrkamp verlag
Rousseau und Kant als Kronzeugen
Ingeborg Maus war eine der wichtigsten Demokratietheoretikerinnen der Nachkriegszeit.
Nun ist sie im Alter von 87 Jahren gestorben.
von Peter Niesen
Frankfurter Rundschau v. 16.12.2024, S. 25
Ingeborg Maus’ Lebensthema war die Kritik demokratischer Regression. Im Unterschied zum autoritären Populismus der Gegenwart, für dessen Erstarken heute oft die Wahlbevölkerung verantwortlich gemacht wird, nahm Maus die politischen Institutionen von Verwaltung und Justiz für die Entwertung demokrati scher Entscheidungsbefugnisse in Haftung.
Mit unerbittlicher Schärfe beklagte sie seit den späten 1960er Jahren die schleichende Ersetzung demokratischer Gesetzgebung und „Usurpation“ der Verfassung durch die Justizorgane. Was andere seither an der „Post- demokratie“ beklagten und heute für Anhaltspunkte einer „Überkonstitutionalisierung“ halten, die demokratischen Wahlen zunehmend das Vermögen der politischen Richtungsbestimmung nimmt, hatte Maus für die unmittelbare Nachkriegszeit diagnostiziert: eine justizstaatliche Dominanz, in der Gerichte und nicht der Gesetzgeber die Rechtswirklichkeit festlegen.
Unbestechlicher Blick
Seit der Mitte der Sechzigerjahre arbeitete Ingeborg Maus zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin von Carlo Schmid, später von Christian Graf Krockow an der Frankfurter Universität. Mit unbestechlichem Blick untersuchte sie die Theorie und Wirkungsgeschichte Carl Schmitts vor und während des Nationalsozialismus. Nach dem Erscheinen von Maus’ Aufsatz zur angeblichen „Zäsur von 1933“ (1969) suchte Schmitt brieflich einen Kontakt herzustellen, den sie höflich abprallen ließ. In Maus’ Dissertation „Bürgerliche Rechtstheorie und Faschismus“ (2. Aufl. 1980), so beschwerte sich Schmitt später, sehe er sich unerträglicher „Vivisektion“ unterzogen. Ihr zweites Buch, „Rechtstheorie und Politische Theorie im Industriekapitalismus“ (ebenfalls Wilhelm Fink Verlag, München 1986), widmete Maus den Auswirkungen des damals noch nicht völlig globalisierten Kapitalismus auf die Rechtsentwicklung, ein Thema, das angesichts des permanenten staatlichen Krisenmanagements aktueller nicht sein könnte.
Ihre Analysen zu den rechts-soziologischen Arbeiten der Frankfurter Schule, etwa zu Franz Neumanns Behemoth, der den nationalsozialistischen Terror als Freisetzung parallel-unverbundener Herrschaftszusammenhänge begriff, ließen sie noch in Niklas Luhmanns und Gunther Teubners liberalen Theorien zur Selbstkonstitutionalisierung gesellschaftlicher Funktionssysteme, die sich von zentraler Steuerung emanzipieren, das Potenzial entfesselter Herrschaft wittern.
Von 1987 bis 1992 gehörte Maus zu den Mitgliedern der Leibniz-Arbeitsgruppe Rechtstheorie, in der Jürgen Habermas seine Diskurstheorie der Demokratie entwickelte. In dieser Zeit schrieb sie ihr Buch „Zur Aufklärung der Demokratietheorie“, das inzwischen als Klassiker eines demokratischen Gesetzespositivismus gilt. Im Unterschied zu Habermas vertraute Maus nicht auf die kommunikative Unterwanderung der „Staatsapparate“ und setzte ihre Hoffnungen allein in deren rechtsförmige Unterwerfung.
Ihr Werk seit den späten 1980er Jahren, ebenso wie ihre Lehrtätigkeit als Professorin für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Frankfurt von 1992 bis 2003, war daher der Wiederentdeckung der Demokratietheorie der Aufklärung gewidmet. Rousseau und Kant dienten Maus als die Kronzeugen einer Demokratie, die ihren Namen verdient: der gemeinsamen Ausübung von Volkssouveränität, die sich auf die wichtigen Verfassungsfragen beschränkt und die konkrete politische Willensbildung und Entscheidungsfindung dann in dezentrale, rechtlich ungebundene Räume zu verlegen anstrebt.
Dabei liegt der Unterschied zu anderen, heute als radikaldemokratisch verstandenen Konzeptionen auf der Hand: Im Hintergrund der ergebnisoffenen Prozeduren steht bei Maus immer der vernunftrechtliche Freiheitsbegriff des 18. Jahrhunderts, der sich stets auch zugunsten der größtmöglichen Freiheit der anderen in die Bresche wirft. Ihr bedingungsloses Eintreten für den Gesetzespositivismus wurde manchmal als Kritik am Natur- und Vernunftrecht, etwa an der Idee ursprünglicher Freiheitsrechte verstanden, was an ihrer Konzeption völlig vorbeigeht. Allerdings stehe die vernunftrechtliche Berufung auf die „angeborene“ Freiheit einer und eines jeden allein denen an der gesellschaftlichen Basis zur Verfügung, die kein Amt und kein Mandat haben.
Es ging stets ums Ganze
Ihren Studierenden begegnete sie mit wohlwollender Überforderung. Ihre kämpferischen Ausei- nandersetzungen mit der „Gerechtigkeitsexpertokratie“ des Verfassungsgerichts und „seichten“ Spielarten der Ideengeschichte prägten mehr als eine studentische Generation. In Ingeborg Maus’ Seminaren ging es stets ums Ganze: um die großen Fragen von Kapitalismus und Demokratie, Rechtsfunktion und Barbarei. War die Synchronisierung ihrer Eigenzeit mit den Vorgaben der Normaluhr einmal hergestellt, kam es zu Lehrstunden der Herrschaftskritik. Höchstes Lob war, sich in Diskussionen und Publikationen als „kein Idiot“ bewährt zu haben. Das Vokabular von „Widerstand“ und „zivilem Ungehorsam“ klang ihr zu untertänig. Dass Bürger sich auf die Volkssouveränität berufen können, wenn sie zu rechtswidrigen Protestformen greifen, erschien ihr dagegen selbstverständlich. Dies galt auch in ihrer persönlichen Praxis, wie sich anekdotisch belegen lässt. In den Kämpfen um das Grundrecht auf Asyl in den 1990er Jahren hatte sie sich an einem Aufruf beteiligt, Abschiebegefängnisse zu „entzäunen“, was die Frankfurter Polizei zum Anlass nahm, gegen die Initiatoren zu ermitteln. Als die Beamten ihr mitteilten, dass man die Ermittlungen gegen sie einstellen wolle, erklärte sie ihnen geduldig, dass sie das Prinzip der Volkssouveränität falsch verstanden hätten.
Aus der Volkssouveränität folge ein Anspruch auf gerechtfertigten Rechtsbruch, nicht auf Straflosigkeit: Sie bitte darum, an der Verfolgung festzuhalten. Auf den neuesten Stand hat Maus ihre Demokratietheorie in dem von Tim Eckes redigierten Werk „Über Volkssouveränität“ (Suhrkamp 2011) gebracht. Seit dem Jugoslawienkrieg kämpfte sie publizistisch gegen ethnisch geprägten Staatszerfall ebenso wie gegen humanitäre militärische Intervention. Ihr vorletztes Buch, „Menschenrechte, Demokratie und Frieden“, widmete sie 2015 der Kritik des gewaltsamen Demokratieexports; im Januar 2018 erschienen ebenfalls bei Suhrkamp ihre gesammelten Justizkritiken unter dem Titel „Justiz als gesellschaftliches Über-Ich“. Zu ihrem geplanten Rousseau-Buch ist sie nicht mehr gekommen. Ingeborg Maus starb am 14. Dezember im Alter von 87 Jahren.
Peter Niesen ist Professor
für Politische Theorie an der Universität Hamburg.